Syro-malabarische Messe in Hochdorf
Zum Ende der Adventszeit durften wir in St. Peter, Hochdorf in der gut besetzten Kirche einen Gottesdienst der besonderen Art mitfeiern. Aus der ganzen Pfarrei Heiliger Sebastian, ja sogar aus der früheren Pfarrei von Pater Jaimon waren Gläubige gekommen. Er zelebrierte die heilige Messe nach dem Syro-malabarischen Ritus.
Zum besseren Verständnis gab er vor dem Gottesdienst folgende Einführung:
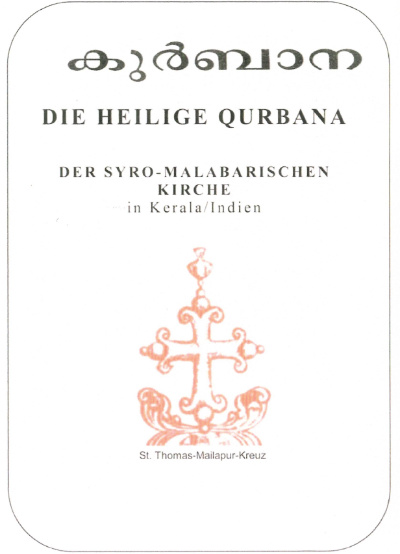
„In Indien gibt es drei katholische Riten: Syro-malabarisch, Syro-malankarisch und den lateinischen Ritus. Der Apostel Thomas kam nach Indien im Jahr 52 nach Christus. Seit damals gibt es in Indien Christentum. Diese Christen nennen sich heute „Thomas Christians“, und deren Liturgie ist ähnlich wie die Liturgie der Ostkirche. Der Name „Syro-malabarisch“ ist eine Kombination aus den Worten „Syrisch“ und „Malabarisch“. Seit dem 4. Jahrhundert nach Christus war die Syro-malabarische Kirche sehr stark mit der syrischen Kirche verbunden, die ja zur gleichen „Apostolischen Familie“ gehört. Der heutige indische Bundesstaat Kerala an der Südwestküste des Landes war früher bekannt als „Malabar“. Hier ist die fast 2000 Jahre alte Syro-malabarische Kirche zu Hause, zu der mehr als 3,5 Millionen Gläubige gehören.
In unserem Ritus gibt es drei Hochgebete, aber wegen der Länge wird nur ein Hochgebet praktiziert. Bis zum 2. Vatikanischen Konzil hat man bei uns auch die heilige Messe in syrischer Sprache gelesen, so wie hier die lateinische Messe.
Dieser Text ist die kürzeste Form. Der erste Teil – Wortgottesdienst – fängt bei uns immer vor dem Altar und Vorhang mit der Gemeinde an. Das symbolisiert: Wir sind alle Pilger und unterwegs zum himmlischen Leben, zum himmlischen Jerusalem. Der Altarraum symbolisiert das himmlische Jerusalem.
Nach der Lesung wird das Evangelium feierlich vom Hochaltar zum Ambo getragen. Beim Evangelium erinnern wir uns an das öffentliche Leben Jesu. Die Prozession mit dem Evangelium zum Hochaltar bedeutet das Ankommen der Menschwerdung Jesu in der Welt. Während der Fürbitten werden die Priester die Gaben – Brot und Wein – vorbereiten.
Friedensgruß geben wir nicht am Schluss, sondern vor dem Hochgebet. Friedensgruß, ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung, ist hier sehr passend. Beim Friedensgruß sagen wir einander: Ich liebe dich, bitte vergib mir meine Sünden. Es ist recht, dass wir uns versöhnen durch eine Reinigung der Herzen von Hass und Feindschaft und dann würdig die Eucharistie feiern. Jesus Christus ist durch seine Rettungstat am Kreuz und danach durch seine Auferstehung unser Frieden geworden.
Das Schuldbekenntnis beten wir in unserer Liturgie vor dem Empfang der heiligen Kommunion und nicht am Anfang wie im lateinischen Ritus.
Das Vaterunser-Gebet beten wir zweimal – am Anfang und auch vor der heiligen Kommunion – (und nochmal vor dem Schlusssegen).
Im lateinischen Ritus legen wir mehr Wert auf die Erlösung der Menschheit durch den Kreuzestod Jesu. Im Syro-Malabarischen Ritus legen wir den Akzent auf die Auferstehung Jesu. In der Syro-Malabarischen Liturgie wird besonders die Opfergabe Jesu am Kreuz betont, vollendet in der Auferstehung. Stark betont sind der Lobpreis und die Danksagung an die Dreifaltigkeit. Wie in allen ostkirchlichen Liturgien ist die Verehrung des Heiligen Geistes sehr bedeutend. Alle Gläubigen haben einen aktiven Teil in der Liturgie, weil alle in der Taufe ein priesterliches Volk geworden sind.
Wir haben drei Hochgebete – 1) Anaphora der seligen Apostel Mar Addai und Mar Mari, Kirchenlehrer des Ostens, 2) Anaphora des Teodor von Mopsuestia und 3) Anaphora des Nestorius. Das Hochgebet in der orientalischen Liturgie wurde ursprünglich ohne Einsetzungsworte benutzt; sie sind später aus dem lateinischen Ritus übernommen worden. Aber sehr wichtig ist die Epiklesis. Papst Johannes Paul II hat bei der Assyrienischen Liturgie das Hochgebet ohne Einsetzungswort gültig bestätigt. Das Kreuz nennen wir das Thomas-Kreuz, und wir legen es auf den Altar.
Sitzen und Stehen können Sie ähnlich wie im lateinischen Gottesdienst.“


Die eingesetzten Lieder wurden von indischen Frauen in der Landessprache gesungen.
Dieser feierliche Gottesdienst endete mit großer Begeisterung der Gottesdienstbesucher und viel Applaus.
St. Thomas-Kreuz
Mehrere Ostasien-Kirchen sehen im heiligen Apostel Thomas den Vater ihrer Glaubensverkündigung. Im 1. Jh. nach Christi gab es verschiedene Handelsbeziehungen zwischen Vorderasien, Europa und Indien. Es kamen z.B. jüdische und persische Händler nach Indien. Nach der Überlieferung kam damals auch der heilige Apostel Thomas nach Indien. Die südindische Kirche stand in enger Beziehung zu den ostsyrischen Christen, den Chaldäern und Persern. Das heutige sogenannte St. Thomas-Kreuz ist eine Abwandlung des in Persien und Mesopotamien verehrten Kreuzes.
Das St. Thomas-Kreuz ist das Wahrzeichen der Thomas-Christen. Dieses Kreuz, das im 7. Jh. aus Stein gehauen wurde, befindet sich auf dem Thomas-Berg in Indien. Dort starb Sankt Thomas 72 n. Chr. als Märtyrer.
Symbolische Darstellungen
1. Drei steinerne Stufen symbolisieren das Leiden Christi auf Gogota.
2. Der Fuß des Kreuzes steht in einer Lotusblüte. Diese Blüte ist in der Religion der Hindus und Buddhisten ein heiliges und wichtiges Symbol. Warum ist da Thomas-Kreuz mit diesem Symbol der Andersgläubigen verbunden? Es soll uns zeigen, dass sowohl Buddhisten als auch Hindus unseren christlichen Glauben tolerieren und uns menschlich akzeptieren.
3. Die vier Arme des Kreuzes enden in den Blütenknospen. Diese Knospen sind Zeichen für die Auferstehung Jesu und das neue Leben. Das Kreuz zeigt nicht den Gekreuzigten; es betont die Auferstehung.
4. Die Taube auf der Spitze des Kreuzes ist das Zeichen für das Wirken des Heiligen Geistes.
